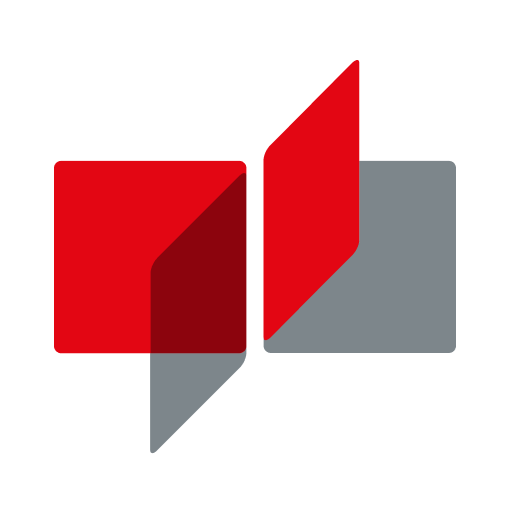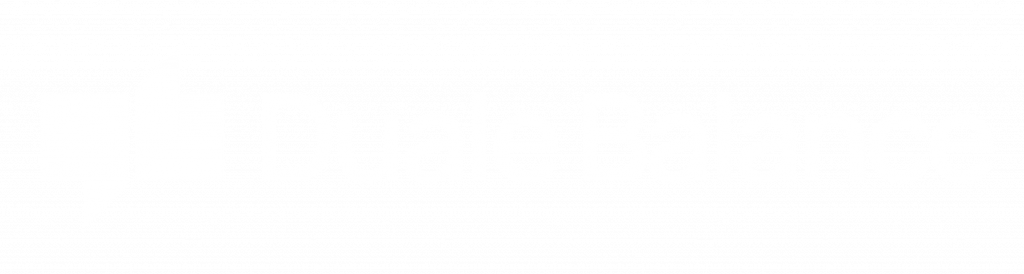Was wird in diesem Kurs behandelt?
- Nachhaltigkeit im Alltag: Sie erfahren, wie Sie durch kleine, praktische Schritte im Alltag – sei es beim Einkaufen, Reisen, Konsumieren oder Entsorgen – einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können, ohne sich überfordert zu fühlen.
- Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst: In diesem Kurs werden Möglichkeiten gezeigt, wie Sie durch bewusste Selbstfürsorge, Stressbewältigung und Reflexion Ihre mentale und körperliche Gesundheit stärken können.
- Soziale Nachhaltigkeit: Achtsamkeit bedeutet auch, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Wir betrachten Wege, wie respektvolle Kommunikation, Empathie und gegenseitige Wertschätzung zu einem fairen und unterstützenden Miteinander beitragen.
Ziel des Kurses
Das Ziel des Kurses ist es nicht, Perfektion zu erreichen, sondern einen Raum für Bewusstsein, Reflexion und Veränderung zu schaffen. Nachhaltigkeit beginnt bei jedem Einzelnen – mit unseren täglichen Entscheidungen, unserem Verhalten und unserer Haltung. In diesem Kurs wollen wir gemeinsam neue Perspektiven vermitteln, voneinander lernen und konkrete Werkzeuge mitnehmen, die sich möglichst leicht im eigenen Leben umsetzen lassen.
Dieser Kurs soll den Austausch fördern, inspirierende Impulse geben und Sie auf eine gemeinsame Reise hin zu einem bewussteren Leben führen – im Einklang mit sich selbst, mit anderen und mit unserer Umwelt.
Lektion 1: Grundlagen zum Thema Nachhaltigkeit

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologische, soziale und ökonomische Aspekte
Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur Umweltschutz. Um ein Gleichgewicht zu schaffen, das
langfristig tragfähig ist, müssen drei zentrale Dimensionen miteinander in Einklang gebracht werden: die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Diese „drei Säulen“ bilden gemeinsam das Fundament für eine lebenswerte Zukunft.
- Ökologische Nachhaltigkeit
Diese Dimension beschäftigt sich mit dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Es geht darum, Ressourcen wie Wasser, Luft, Boden und Energie so zu nutzen und zu schonen, dass sie auch kommenden Generationen zur Verfügung stehen. Dazu gehören Maßnahmen wie der Erhalt der Artenvielfalt, der Schutz von Ökosystemen, der verantwortungsvolle Umgang mit Konsumgütern und die Reduzierung von Emissionen und Abfall.
Dies sind die Fragen, die wir uns hier stellen:
- Wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck verkleinern?
- Welche Alternativen gibt es zu umweltschädlichen Produkten oder Verhaltensweisen?
- Soziale Nachhaltigkeit
Soziale Nachhaltigkeit zielt auf ein faires, inklusives und respektvolles Miteinander ab. Sie stellt den Menschen und seine Lebensqualität in den Mittelpunkt. Dazu zählen soziale Gerechtigkeit, Bildung, Chancengleichheit, sichere Arbeitsbedingungen und ein friedliches Zusammenleben. Auch Achtsamkeit und Wertschätzung im Alltag sind Teil sozialer Nachhaltigkeit.
Fragen, die wir uns hier stellen:
- Wie kann ich mich am besten in andere Menschen hineinversetzen
- Wie kann ich zu einem respektvollen und fairen Miteinander beitragen
- Ökonomische Nachhaltigkeit
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet, wirtschaftliche Prozesse so zu gestalten, dass sie langfristig tragfähig sind – ohne dabei Umwelt und Gesellschaft auszubeuten. Ziel ist ein stabiles Wirtschaftssystem, das Innovation, Beschäftigung und Wohlstand ermöglicht, aber zugleich Ressourcen schont und soziale Verantwortung übernimmt.
Fragen, die wir uns hier stellen:
- Wie kann ich bewusst konsumieren und trotzdem nachhaltig wirtschaften?
- Welche Unternehmen oder Produkte fördern faire und nachhaltige Praktiken?
Sie sehen also:
Nachhaltigkeit ist ein ganzheitliches Konzept. Erst wenn ökologische, soziale und ökonomische Interessen miteinander abgestimmt werden, entsteht ein zukunftsfähiges Gleichgewicht. In diesem Kurs wollen wir Wege aufzeigen, wie Sie diese Prinzipien konkret und alltagstauglich in Ihr Leben integrieren können – Schritt für Schritt, achtsam und wirkungsvoll.
Nachhaltigkeit beginnt mit Achtsamkeit: Die Verbindung von bewusstem Leben und verantwortungsvollem Handeln
Nachhaltigkeit im Alltag ist weit mehr als das Recyceln von Müll oder der Verzicht auf Plastik und Ressourcen zu schonen. Sie beginnt mit einem Moment der Achtsamkeit – mit dem bewussten Hinschauen auf das, was wir tun, konsumieren, denken und weitergeben. Nur wenn wir uns unserer Entscheidungen wirklich bewusst werden, können wir beginnen, sie nachhaltig zu gestalten.
Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt präsent zu sein, den eigenen Lebensstil zu beobachten und ehrlich zu reflektieren:
- Wie lebe ich?
- Was ist mir wirklich wichtig?
- Welche meiner Gewohnheiten fördern Nachhaltigkeit – und welche behindern sie?
Diese Reflexion eröffnet Raum für Veränderung. Sie lädt dazu ein, innezuhalten statt nur automatisch zu handeln: Muss ich dieses Produkt wirklich kaufen? Wie wurde es hergestellt? Wie wirkt sich mein Konsum auf andere Menschen oder auf die Umwelt aus?
Indem wir lernen, unsere Bedürfnisse besser zu erkennen – statt sie unbewusst mit Konsum zu überdecken – entsteht ein Lebensstil, der nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch ausgeglichener und erfüllter ist. Achtsamkeit fördert auch Mitgefühl – mit uns selbst, mit anderen und mit der Welt, in der wir leben.
Ein nachhaltiger Lebensstil braucht Selbstwahrnehmung
Nachhaltigkeit ist keine Checkliste, sondern ein innerer Prozess. Es geht nicht um Perfektion, sondern um bewusste Entscheidungen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Jeder Schritt zählt – und je achtsamer wir mit uns selbst und unserer Umwelt umgehen, desto klarer wird, wie eng unser Wohlbefinden mit dem Zustand unseres Planeten verbunden ist.
Merke: Achtsamkeit ist der Schlüssel, der die Tür zu einem nachhaltigeren Leben öffnet. Wer achtsam lebt, lebt bewusster – und wer bewusster lebt, kann Verantwortung übernehmen – für sich, für andere und für die Welt.
Lektion 2: Nachhaltigkeit im Alltag Leben

Nachhaltigkeit bedeutet, so zu leben, dass unsere Handlungen die Bedürfnisse zukünftiger Generationen nicht einschränken. Im Alltag kann das oft einfacher sein, als man denkt. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen – sondern darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und nach und nach Gewohnheiten zu verändern. Viele kleine Schritte können gemeinsam eine große Wirkung entfalten.
Hier sind 20 praktische Tipps, wie Sie Nachhaltigkeit in Ihren Alltag integrieren können – unkompliziert und wirkungsvoll:
- Einkaufen & Konsum
- Regional und saisonal einkaufen – Das spart Transportwege und unterstützt lokale Betriebe.
- Plastik vermeiden – Greif zu unverpackten Lebensmitteln oder bring eigene Beutel mit.
- Weniger, aber bewusster konsumieren – Frage dich vor jedem Kauf: Brauche ich das wirklich?
- Secondhand nutzen – Kleidung, Möbel oder Technik gebraucht kaufen oder tauschen. Nebenbei können Sie sich sogar etwas dazuverdienen, wenn Sie Kleidung verkaufen, die Ihnen nicht mehr passt oder die Sie nicht mehr mögen.
- Auf Siegel achten – Bio, Fairtrade, FSC oder Blauer Engel geben Orientierung beim Einkauf.
- Ernährung
- Mehr pflanzlich essen – Weniger Fleisch und Milchprodukte entlasten Klima und Umwelt.
- Reste verwerten – Plane Mahlzeiten, friere Reste ein oder koche kreativ aus Übriggebliebenem.
- Leitungswasser trinken – Spart Geld und Plastikflaschen. In Deutschland ist es hochwertig.
- Selber kochen statt Fertigprodukte – Reduziert Verpackungsmüll und ist meist gesünder.
- Saisongemüse bevorzugen – Spart Energie für Lagerung und lange Transporte.
- Mobilität & Reisen
- Öfter zu Fuß gehen oder Rad fahren – Gut für die Umwelt und die Gesundheit.
- ÖPNV statt Auto – Bus, Bahn oder Carsharing nutzen, wenn möglich.
- Flugreisen überdenken – Lieber weniger, dafür bewusster reisen und Alternativen prüfen.
- Reisen in der Region entdecken – Nachhaltigkeit beginnt vor der eigenen Haustür.
- Wohnen & Alltag
- Energie sparen – Licht ausschalten, Geräte nicht im Standby lassen, auf effiziente Technik achten.
- Wasser bewusst nutzen – Kurz duschen, Wasserhahn zudrehen beim Zähneputzen.
- Reparieren statt wegwerfen – Kleidung nähen, Elektrogeräte instand setzen (z. B. in sogenannten Repair Cafés!).
- Grüne Energie beziehen – Stromanbieter wechseln zu Ökostrom.
- Digitalen Konsum reduzieren – Weniger Streaming, weniger Geräte, bewusster Umgang mit Daten.
- Achtsam leben – Wer sich Zeit nimmt und bewusst lebt, trifft automatisch nachhaltigere Entscheidungen.
Wertvolle Tipps zu diesem Thema gibt beispielsweise auch dieses Video:
Merke:
Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – mit unseren Alltagsentscheidungen, unseren Gewohnheiten und unserer Haltung. Du musst nicht alles auf einmal ändern. Jeder Schritt zählt. Fang dort an, wo es für dich gerade passt – und bleib dran. Gemeinsam können wir viel bewirken.
Nachhaltigkeit im Alltag konkret umsetzen – Bewusst leben in sechs Bereichen
Nachhaltigkeit beginnt also dort, wo wir täglich Entscheidungen treffen: beim Einkaufen, Kochen, Wohnen, Unterwegssein. Wer nachhaltiger leben möchte, muss nicht alles umkrempeln – entscheidend ist, mit Bewusstsein zu handeln. Die folgenden sechs Bereiche zeigen, wie Nachhaltigkeit konkret und alltagstauglich gelebt werden kann – auch wenn es schon einmal in den Tipps vorher erwähnt wurde:
- Konsumverhalten: Weniger, bewusster, besser
Unser Konsum hat direkten Einfluss auf Umwelt, Klima und Arbeitsbedingungen weltweit. Nachhaltiger Konsum bedeutet, sich vor dem Kauf zu fragen: Brauche ich das wirklich?
- Qualität vor Quantität: Langlebige und wiederverwendbare Produkte kaufen statt Wegwerfartikel.
- Faire und ökologische Siegel beachten: z. B. Fairtrade, GOTS, FSC, Blauer Engel.
- Secondhand statt neu: Kleidung, Bücher, Möbel oder Technik gebraucht kaufen. Schauen Sie beispielsweise auch mal bei Buchtauschstationen im Supermarkt, ob Sie dort etwas finden.
- Reparieren statt ersetzen: Viele Dinge lassen sich leicht wieder nutzbar machen.
- Minimalismus: Platz schaffen für das Wesentliche
Minimalismus ist eine Lebensweise, die bewusst auf Überfluss verzichtet und Raum schafft – für Zeit, Klarheit und Zufriedenheit.
- Weniger besitzen, aber dafür gezielter nutzen.
- Regelmäßig ausmisten und ungenutzte Dinge verschenken, verkaufen oder spenden.
- Bewusst konsumieren: Qualität, Funktion und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt stellen.
- Zeit statt Zeug – in Erlebnisse, Beziehungen und Selbstfürsorge investieren.
- Nachhaltige Ernährung: Gut für Körper und Klima
Unsere Ernährungsweise beeinflusst Umwelt und Gesundheit. Nachhaltige Ernährung basiert auf Pflanzen, Regionalität und Achtsamkeit.
- Mehr pflanzlich essen, weniger tierische Produkte – das spart Ressourcen und Emissionen.
- Saisonal und regional einkaufen, z. B. auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen.
- Lebensmittelverschwendung vermeiden: Reste verwerten, richtig lagern, kreativ kochen. Einkäufe besser planen – das freut auch den Geldbeutel
- Wasser trinken statt Softdrinks – spart Müll, Zucker und Energie.
- Energieverbrauch: Weniger ist mehr
Energie bewusster zu nutzen, schont Umwelt und Geldbeutel. Schon kleine Veränderungen machen einen Unterschied.
- Beleuchtung umstellen auf LED und Geräte ganz ausschalten statt auf Standby.
- Heizung bewusst nutzen – Temperatur senken, Stoßlüften statt Dauerlüften.
- Wasser sparen: Sparduschköpfe, kurze Duschzeiten, Waschmaschine und Spülmaschine voll beladen.
- Ökostrom-Anbieter wählen – ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt.
- Mobilität: Klimafreundlich unterwegs sein
Verkehr ist eine der größten Quellen von CO₂. Nachhaltige Mobilität reduziert Emissionen und verbessert die Lebensqualität.
- Kurze Strecken zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen – das fördert zugleich Ihre Gesundheit
- Öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Fahrgemeinschaften bilden.
- Carsharing statt eigenem Auto – spart Kosten und Ressourcen.
- Flugreisen reduzieren – Bahn oder Bus sind oft entspannter und klimafreundlicher.
- Ressourcenschonendes Wohnen: Nachhaltigkeit zu Hause leben
Auch in den eigenen vier Wänden kann man umweltfreundlich leben – durch bewusste Einrichtung und sparsamen Umgang mit Ressourcen.
- Möbel aus nachhaltigen Materialien oder aus zweiter Hand wählen.
- Naturmaterialien statt Plastik: z. B. Holz, Glas, Leinen, Keramik.
- Weniger Wohnfläche = weniger Energieverbrauch – Downsizing bewusst in Erwägung ziehen.
- Pflanzen zur Luftverbesserung und Wohlbefinden nutzen – grün wohnen hilft auch der Seele.
Merke:
Nachhaltigkeit im Alltag bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das eigene Leben. Durch achtsame Entscheidungen in den Bereichen Konsum, Ernährung, Mobilität und Wohnen kann jeder Mensch einen Unterschied machen. Es sind nicht die großen Sprünge, sondern die vielen kleinen Schritte, die zählen.
Lektion 3: Achtsamkeit als Lebenserhaltung – In der Gegenwart ankommen und inneren Halt finden

In einer Welt, die oft laut, hektisch und überfordernd ist, wird Achtsamkeit zu einer Form der Lebenserhaltung – einer inneren Ressource, die uns hilft, mit den Herausforderungen des Alltags verbunden, klar und gesund umzugehen. Achtsamkeit bedeutet, den Moment bewusst wahrzunehmen – ohne zu urteilen, ohne zu bewerten, einfach nur zu beobachten, was ist.
Achtsamkeit ist keine Flucht aus dem Leben – sie ist das genaue Gegenteil: ein radikales Ankommen im Leben, wie es gerade ist. Wer achtsamer ist, lebt auch nachhaltiger, denn diese Menschen nehmen ihre Umwelt anders und bewusster wahr.
Grundlagen der Achtsamkeit
Die Praxis der Achtsamkeit basiert auf einigen einfachen, aber tiefgreifenden Prinzipien:
- Gegenwärtigkeit: Den jetzigen Moment bewusst erleben, statt in Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft zu verweilen.
- Akzeptanz: Annehmen, was gerade da ist – Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen – ohne Widerstand oder Verdrängung.
- Nicht-Urteilen: Beobachten ohne sofort zu bewerten. Dinge einfach so sein lassen, wie sie sind.
- Geduld & Freundlichkeit: Sich selbst und dem Prozess mit Geduld und Mitgefühl begegnen.
Diese Grundhaltungen helfen dabei, aus dem Autopilot-Modus auszusteigen und wieder bewusst mit sich selbst und der Welt in Kontakt zu treten.
Techniken zur Stressbewältigung
Achtsamkeitsübungen können helfen, den eigenen Körper und Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und die Selbstwahrnehmung zu stärken. Hier sind drei zentrale Techniken, die leicht in den Alltag integriert werden können:
- Atemmeditation
Der Atem ist immer da – er verbindet Körper und Geist.
- Setzen Sie sich aufrecht und ruhig hin.
- Richten Sie die Aufmerksamkeit auf den Atem: Ein- und Ausatmen beobachten.
- Wenn Gedanken auftauchen (was ganz normal ist), freundlich wahrnehmen und zum Atem zurückkehren. Diese Übung hilft, zur Ruhe zu kommen, Gedanken loszulassen und im Moment zu verweilen.
- Body Scan
Ein achtsames Wahrnehmen des Körpers, ideal zur Entspannung und Selbstwahrnehmung.
- Legen Sie sich bequem hin, schließe die Augen.
- Wandern Sie mit der Aufmerksamkeit langsam durch den Körper – von den Füßen bis zum Kopf.
- Nehmen Sie Empfindungen, Spannungen, Wärme, Kälte oder Taubheit einfach wahr – ohne sie verändern zu wollen. Diese Technik schult das Körperbewusstsein und fördert eine liebevolle Verbindung zum eigenen Selbst.
- Achtsames Gehen
Bewegung mit Aufmerksamkeit verbinden – eine kraftvolle Übung für den Alltag.
- Gehen Sie langsam und bewusst, am besten draußen oder in einem ruhigen Raum.
- Spüren Sie, wie die Füße den Boden berühren, wie sich dein Körper beim Gehen bewegt.
- Atmen Sie bewusst und nehmen Sie die Umgebung ohne Bewertung wahr.
Diese Übung bringt den Geist zur Ruhe und stärkt die Präsenz.
Wirkung: Selbstwahrnehmung, Präsenz und innere Ruhe
Regelmäßige Achtsamkeitspraxis führt zu spürbaren Veränderungen:
- Stress reduziert sich, da wir lernen, auf Reize nicht automatisch zu reagieren.
- Selbstwahrnehmung wächst: Wir erkennen unsere Grenzen, Bedürfnisse und Emotionen klarer.
- Die Präsenz im Alltag verbessert sich – wir sind wacher, konzentrierter und einfühlsamer.
- Innere Ruhe entsteht, weil wir uns nicht mehr in Gedanken oder Sorgen verlieren.
Fazit
Achtsamkeit ist kein Luxus, sondern eine lebenswichtige Praxis, um gesund, wach und verbunden zu bleiben – mit sich selbst und der Welt. Inmitten von Reizüberflutung, Leistungsdruck und ständiger Ablenkung ermöglicht sie uns, den Blick nach innen zu richten und dem eigenen Leben bewusst zu begegnen. So trägt Achtsamkeit zu einer stärkeren Wahrnehmung der Umwelt du der Ressourcen und so zu einer Form der Lebenserhaltung bei – im wahrsten Sinne des Wortes.
Lektion 4: Soziale Nachhaltigkeit und Miteinander – Verbindung durch Achtsamkeit und Mitgefühl

Nachhaltigkeit endet nicht beim Umweltschutz – sie beginnt auch zwischen uns Menschen. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, Beziehungen und Gemeinschaften so zu gestalten, dass sie langfristig tragfähig, gerecht und wertschätzend sind. In einer Welt, die immer vernetzter, aber auch oft anonymer wird, sind Empathie, Mitgefühl und achtsame Kommunikation entscheidend für ein friedliches und respektvolles Miteinander.
Empathie und Mitgefühl – Die Basis menschlicher Verbindung
- Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen – ihre Gefühle, Gedanken oder Bedürfnisse nachzuvollziehen.
- Mitgefühl geht einen Schritt weiter: Es beinhaltet den Wunsch, anderen beizustehen oder sie zu unterstützen, wenn sie leiden oder Hilfe brauchen.
Beides sind keine angeborenen Eigenschaften, sondern Fähigkeiten, die durch Achtsamkeit gestärkt werden können. Wer bei sich selbst präsent ist, kann auch besser bei anderen sein.
Achtsame Kommunikation – Zuhören mit dem Herzen
Ein achtsames Miteinander beginnt mit der Art, wie wir miteinander sprechen – und zuhören. In der achtsamen Kommunikation geht es darum, echt, klar und respektvoll zu sein.
Was heißt das konkret?
- Aktives Zuhören: Nicht nur hören, was gesagt wird – sondern wirklich da sein, ohne zu unterbrechen oder zu bewerten und auch Zeichen sehen, die von anderen unbewusst ausgesendet werden.
- Wertschätzend sprechen: Ich-Botschaften nutzen, statt Vorwürfe zu machen. Offenheit zeigen statt zu urteilen.
- Pausen zulassen: Nicht alles muss sofort beantwortet oder gelöst werden. Raum hilft, tiefer zu verstehen.
- Körpersprache bewusst wahrnehmen: Auch Gestik, Mimik und Tonfall tragen zur Verständigung bei.
Ein positives soziales Klima schaffen – Jeder Beitrag zählt
Wer achtsam kommuniziert und empathisch handelt, wirkt positiv auf sein Umfeld – sei es im privaten Bereich, im Berufsleben oder in der Nachbarschaft.
Soziale Nachhaltigkeit zeigt sich z. B. darin,
- wie wir mit Schwächeren umgehen,
- wie wir Unterschiede anerkennen,
- wie wir Konflikte lösen,
- wie wir Gemeinschaft stärken.
Es geht darum, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern auch Verantwortung für das Miteinander zu übernehmen. Ein wertschätzender Umgang ist wie ein Kreislauf: Wer sich gehört, verstanden und respektiert fühlt, gibt dies auch an andere weiter.
Merke
Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, menschliche Beziehungen achtsam zu pflegen. Durch Empathie, Mitgefühl und wertschätzende Kommunikation entsteht ein Klima des Vertrauens, der Offenheit und des Respekts. Und das beginnt bei jedem Einzelnen. Denn wie wir miteinander umgehen, bestimmt die Qualität unserer Gemeinschaft – heute und in Zukunft.
Lektion 5: Nachhaltige Beziehungen zu sich selbst – Die Basis für bewusstes und gesundes Leben

Nachhaltigkeit beginnt nicht im Außen, sondern bei uns selbst. Wie wir mit uns umgehen, wie wir auf unsere Bedürfnisse hören, mit unserer Energie haushalten und unsere Werte leben – all das beeinflusst, wie wir anderen begegnen und welche Entscheidungen wir im Alltag treffen. Eine nachhaltige Beziehung zu sich selbst ist daher die Grundlage für ein ausgeglichenes, verantwortungsvolles und bewusstes Leben.
Dieses Modul lädt dazu ein, sich selbst besser kennenzulernen, liebevoller mit sich umzugehen und innere Klarheit zu entwickeln – als Voraussetzung für nachhaltiges Handeln.
Selbstfürsorge – Mehr als ein Wellness-Tag
Selbstfürsorge bedeutet, sich selbst ernst zu nehmen: die eigenen Bedürfnisse, Gefühle, Grenzen und Wünsche zu erkennen und zu achten.
Es geht darum, sich regelmäßig Pausen zu gönnen, sich emotional zu regulieren und sich in schwierigen Zeiten nicht zu überfordern.
Fragen, die uns dabei unterstützen können:
- Was tut mir gut – körperlich, seelisch, mental?
- Wie kann ich meine Energiereserven bewusst aufladen?
- Wo bin ich zu streng mit mir – und wo darf ich milder sein?
Umgang mit digitalen Medien – Bewusst statt getrieben
Digitale Medien sind fester Bestandteil unseres Lebens – und gleichzeitig eine ständige Quelle
für Reizüberflutung, Vergleich und Ablenkung. Ein nachhaltiger Umgang mit sich selbst bedeutet auch, digital achtsam zu sein:
- Bildschirmzeiten reflektieren: Wofür nutze ich mein Handy? Was nährt mich – was erschöpft mich?
- Bewusste Offline-Zeiten einplanen, z. B. digitale Pausen oder handyfreie Räume.
- Digitale Entgiftung („Digital Detox“) ausprobieren, um wieder mehr Präsenz im Alltag zu erfahren.
Grenzen setzen – Für sich selbst einstehen
Grenzen zu setzen ist ein Akt der Selbstachtung. Es bedeutet, Nein zu sagen, um sich selbst treu zu bleiben – ohne Schuldgefühl.
Nachhaltige Selbstbeziehungen entstehen, wenn wir:
- unsere eigenen Kapazitäten kennen und respektieren,
- lernen, in Beziehungen klar und ehrlich zu kommunizieren,
- zwischen „Ich will helfen“ und „Ich überfordere mich“ unterscheiden.
Grenzen schützen unsere Kraft und geben unserem Leben Struktur.
Persönliche Werte reflektieren – Was ist mir wirklich wichtig?
Unsere Werte sind unser innerer Kompass. Sie geben Orientierung, wenn wir vor Entscheidungen stehen, und helfen, Prioritäten zu setzen.
Nachhaltigkeit beginnt, wenn wir uns fragen:
- Wofür stehe ich im Leben?
- Welche Werte möchte ich in meinem Alltag leben – auch im Kleinen?
- Welche Entscheidungen stärken mein Wohlbefinden UND meine Verantwortung gegenüber anderen?
Wer seine Werte kennt, kann bewusster, klarer und stimmiger handeln – im Einklang mit sich selbst.
Merke:
Nachhaltige Beziehungen zu sich selbst sind kein Egoismus, sondern eine Form der Verantwortung. Wer gut für sich sorgt, ist ausgeglichener, klarer und handlungsfähiger – auch im Einsatz für andere oder für die Umwelt. In diesem Modul geht es darum, achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen, sich selbst ernst zu nehmen und Entscheidungen zu treffen, die dem eigenen Leben und dem großen Ganzen dienen.
Denn: Selbstfürsorge ist gelebte Nachhaltigkeit – von innen nach außen.
Lektion 6: Eigenes Projekt Meine Spur - Nachhaltigkeit selbst erleben

Ziel des Projekts
Die Teilnehmenden wählen ein persönliches oder gemeinsames Nachhaltigkeitsziel, setzen es über einen festgelegten Zeitraum um und dokumentieren dabei ihren Lernprozess, ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge. Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe fördert gegenseitige Motivation und vertieft das Verständnis für nachhaltige Lebensweisen.
Ablauf des Projekts
- Projektstart & Themenfindung
- Einführung ins Thema Nachhaltigkeit im Alltag
- Impulse zu möglichen Schwerpunkten:
- Plastikfrei leben
- Nachhaltig kochen
- Minimalistisch wohnen
- Zero Waste im Badezimmer
- Digital Detox & Achtsamkeit
- Grüne Mobilität
- Individuelle oder Gruppenwahl eines Themas
- Zielformulierung: „Was genau möchte ich ausprobieren oder verändern?“
- Planung & Vorbereitung
- Ziel konkretisieren und genau formulieren
- Material besorgen, Regeln aufstellen, Rahmen festlegen
- Erste Reflexionsfragen:
- Was erwarte ich?
- Wo sehe ich Herausforderungen?
- Was könnte mir helfen, dranzubleiben?
- Durchführungsphase: Nachhaltig handeln
- Die Teilnehmenden leben ihr gewähltes Nachhaltigkeitsprojekt
- Tägliche oder mehrmals wöchentliche Dokumentation (z. B. in Form von):
- Kurznotizen / Tagebuch
- Fotos / Videos
- Skizzen, Collagen
- Sprachnachrichten oder Interviews
- Reflexionshilfe:
- Was war heute leicht/schwer?
- Was habe ich (über mich, das Thema) gelernt?
- Wie habe ich auf Rückschläge reagiert?
- Gruppenaustausch & Peer-Learning (fortlaufend)
- Regelmäßige Treffen oder Online-Austausch
- Erfahrung teilen: „Was habe ich entdeckt?“
- Herausforderungen gemeinsam reflektieren: Was fiel mir besonders schwer? Wo und Wann viel es mir schwer und warum? („W-Fragen“)
- Motivation durch Gruppendynamik
- Abschluss & Präsentation (Woche 3 oder danach)
- Jede Gruppe / jede:r Einzelne erstellt eine kleine Abschlusspräsentation:
- Projektverlauf
- Erfolge & Hindernisse
- Konkrete Learnings
- Was möchte ich beibehalten?
- Formate: Poster, Kurzvortrag, Fotodokumentation, Video, Podcast, Galerie-Walk
- Jede Gruppe / jede:r Einzelne erstellt eine kleine Abschlusspräsentation:
Lernziele
- Nachhaltigkeit durch eigenes Handeln erfahrbar machen
- Reflektieren lernen (individuell & im Team)
- Verantwortung übernehmen und Selbstwirksamkeit erleben
- Austausch & Empathie durch Perspektivenvielfalt
- Kritischer Umgang mit Konsumgewohnheiten
Mögliche Reflexionsfragen (für Zwischendurch oder Abschluss):
- Was hat mich überrascht?
- In welcher Situation habe ich mich überfordert gefühlt – warum?
- Was ist mir besonders gelungen – und warum?
- Was nehme ich für mein weiteres Leben mit?
Ergänzende Materialien (optional):
- Reflexionsbogen oder Tagebuchvorlage
- Checkliste für plastikfreies Einkaufen oder nachhaltiges Kochen
- SMART-Zielformular
- Austauschplattform (Padlet, WhatsApp-Gruppe, Miroboard etc.)
Motto des Projekts:
Das Motto könnte lauten: „Nachhaltigkeit beginnt mit mir – aber wächst mit uns.“
Lektion 7: Abschluss und Transfer: Den Wandel mitnehmen – Nachhaltigkeit vom Projekt in den Alltag übertragen

Ein Nachhaltigkeitsprojekt lebt nicht nur von der Idee oder der Umsetzung über einen begrenzten Zeitraum – seine wahre Wirkung entfaltet sich dann, wenn Erkenntnisse, Erfahrungen und Veränderungen dauerhaft im Alltag verankert werden.
Der Transfer in den Alltag ist entscheidend, um aus einer einmaligen Erfahrung einen nachhaltigen Lebensstil entstehen zu lassen. Das bedeutet: Was während des Projekts ausprobiert, gelernt oder verändert wurde, wird reflektiert und in konkrete, dauerhafte Routinen überführt.
Was erleichtert den Transfer?
- Reflexion & Bewusstsein: Wer sich Zeit nimmt, über Herausforderungen und Erfolge nachzudenken, erkennt besser, was funktioniert – und warum.
Welche neuen Gewohnheiten möchte ich bewusst beibehalten?
- Kleine Schritte statt Perfektion: Der Alltag bietet nicht immer ideale Bedingungen – aber jeder kleine Schritt zählt.
Was kann ich regelmäßig tun, ohne dass es mich überfordert?
- Alltagstaugliche Routinen entwickeln: Nachhaltigkeit wird einfacher, wenn sie zur Gewohnheit wird – z. B. mit festen plastikfreien Einkaufstagen, bewusster Medienzeit oder einem vegetarischen Tag pro Woche.
Wie kann ich mir meine neuen Routinen erleichtern?
- Unterstützung suchen: Im Austausch mit anderen fällt es leichter, dranzubleiben. Familie, Freund:innen oder Gruppen mit ähnlichen Zielen geben Rückhalt.
- Wer kann mich motivieren oder mitmachen?
- Erfolge sichtbar machen: Fortschritt motiviert. Ob durch Tagebuch, Fotos oder kleine Challenges – wer dokumentiert, bleibt bewusster und sieht den eigenen Einfluss.
Worauf bin ich stolz? Was habe ich schon verändert?
Merke:
- Der Alltag ist der Ort, an dem sich echte Veränderung zeigt. Wenn Erfahrungen aus einem Nachhaltigkeitsprojekt in Gewohnheiten übergehen, wird aus einem zeitlich begrenzten Vorhaben eine nachhaltige Haltung. Das braucht keine Perfektion, sondern Mut zur Konsequenz, Offenheit für Weiterentwicklung und Vertrauen in die eigene Wirksamkeit.
„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sondern eine Haltung, die man lebt.“