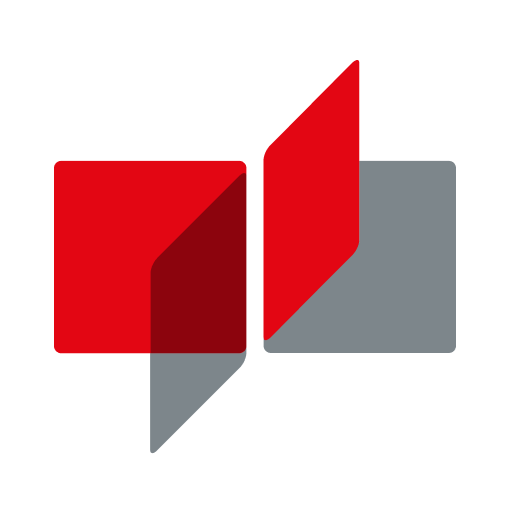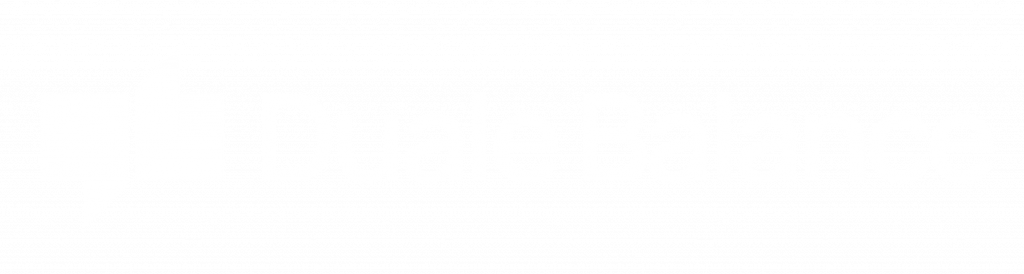Übungskurs: Design Thinking – Von der Idee zur Innovation
Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen des Design Thinking und gibt den Teilnehmenden praktische Werkzeuge an die Hand, um innovative Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Der Kurs umfasst eine Mischung aus Theorie, praxisnahen Übungen und Fallstudien aus der echten Welt.
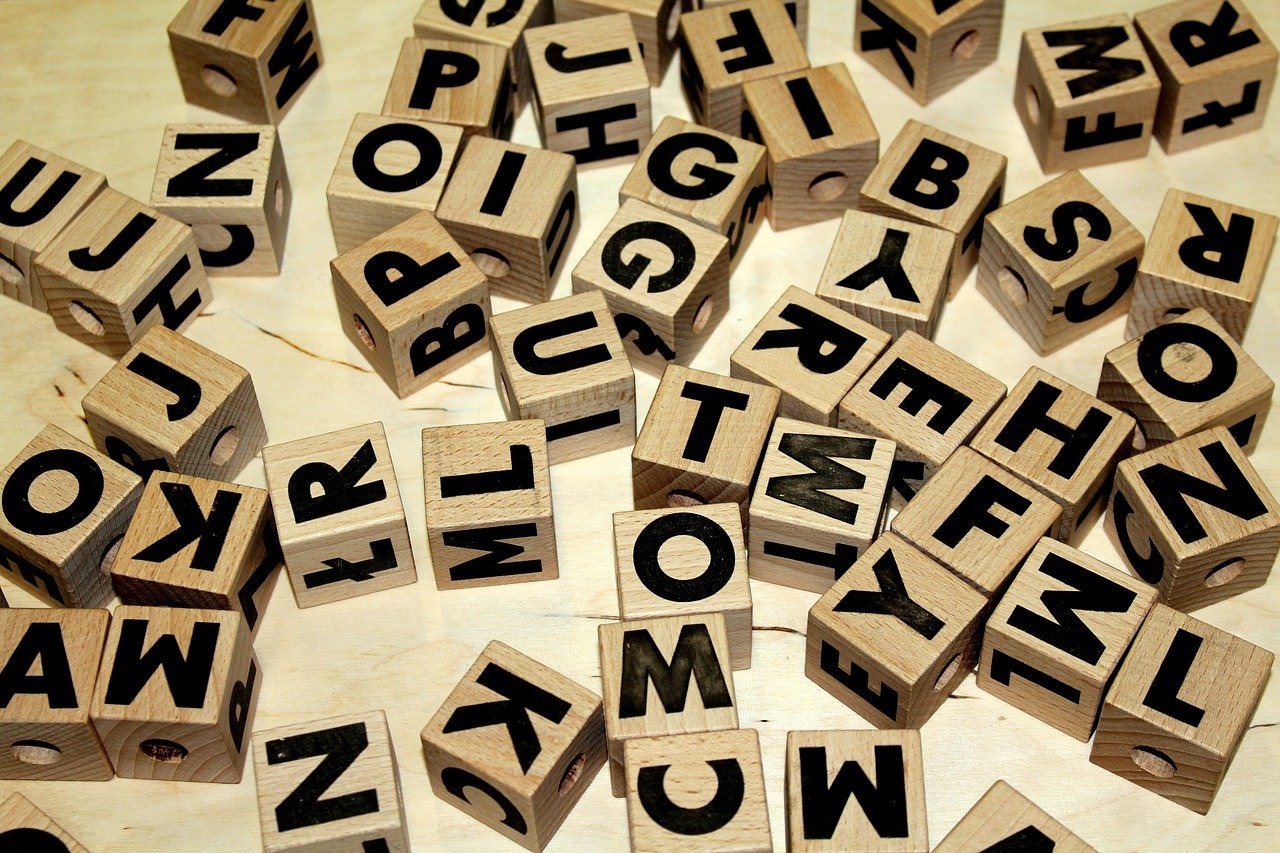
1. Einführung in Design Thinking
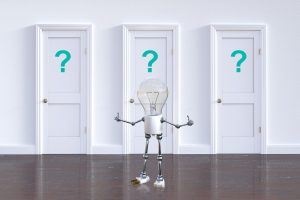
Design Thinking ist ein nutzerzentrierter Innovationsprozess bzw. Denkansatz, der Kreativität und strukturierte Problemlösung kombiniert. Es geht darum, kreativ Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Ursprünglich in der Produkt- und Serviceentwicklung genutzt, wird es heute in vielen Branchen eingesetzt. Ziel von Design Thinking ist es, Lösungen zu finden, die sowohl Nutzer bzw. Anwender überzeugen aber zum anderen auch produkt- und marktorientiert sind.
Die Grundprinzipien von Design Thinking sind:
- Nutzerzentrierung: Die Bedürfnisse und Perspektiven der Zielgruppe stehen im Fokus.
- Kollaboration: Interdisziplinäre Teams ohne feste hierarchische Struture entwickeln bessere Lösungen.
- Experimentieren & Prototyping: Iteratives (schrittweises) Testen von Ideen zur schnellen Verbesserung.
- Kreativität & Flexibilität: Freies Denken zur Erzeugung innovativer Ansätze.
- Fehlerfreundlichkeit: Fehler sind Teil des Lernprozesses.
Ein Beispiel aus dem Bereich Tourismus:
Airbnb nutzte Design Thinking, um sein Geschäftsmodell zu optimieren, indem es erkannte, dass schlechte Fotos die Buchungsraten senkten. Sie schickten professionelle Fotografen zu Gastgebern – und siehe da: Die Buchungen stiegen rapide.
2. Ursprung und Ziel von Design Thinking

Design Thinking ist nicht neu. In der Form, wie wir es heute kennen, reichen seine Wurzeln weit zurück. Seit den 1970er Jahren hat es sich ständig weiterentwickelt und ist heute ein weltweit anerkannter Ansatz zur Lösung komplexer Probleme.
Entwickler und Vertreter des Design Thinkings sind die drei Professoren Terry Winograd, Larry Leifer und David Kelley, dem Gründer der Design- und Innovationsagentur „IDEO“, wo das Konzept schon früh angewendet wurde. Im Jahr 2003 gründeten sie in Stanford die „d.school“. Durch die Unterstützung von Hasso Plattner, dem Gründer der SAP – der erkannte, welches Potential im Design thinking steckt – wurde die „d.school“ im Oktober 2005 in „Hasso Plattner institute of design“ umbenannt. Nach dem Vorbild dieses Instituts nahm dann im Oktober 2007 die „HPI School of Design Thinking“ am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut den Studienbetrieb auf. Seit März 2015 gibt es auch ein Online-Bildungsprogramm zum Design Thinking.
Dank der Beiträge von Institutionen wie der Stanford d.school und Persönlichkeiten wie Hasso Plattner ist Design thinking nun mehr als nur eine Methode – es ist eine Denkweise, die uns hilft, die Welt um uns herum besser zu verstehen und zu gestalten.
Design Thinking entwickelt sich auch heute immer weiter. In einer Welt, die sich ständig verändert und neue Herausforderungen mit sich bringt, bietet dieser Ansatz eine flexible und kreative Methode, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten.
Beim Design Thinking steuert ein Unternehmen mit System die Lösung eines Problems an. Im Unterschied zu den technischen Lösungswegen, die bei der Herstellung eines Produkts im Vordergrund stehen, ist es das Ziel von Design Thinking , die Nutzerwünsche der Kunden in den Vordergrund gestellt. Beim Design Thinking versetzen sich die Mitarbeiter in die
Situation eines Käufers: Was braucht der Käufer wirklich, welche Funktionen wünscht er sich?
Voraussetzung dafür, dass das Design Thinking funktioniert, ist eine ständige Rückkopplung zwischen den Entwicklern und der anvisierten Zielgruppe. Mit vorbereiteten Fragen erfahren die Entwickler beim Design Thinking, welche Ansprüche die Kunden an das Produkt stellen und was sich von dem Produkt wünschen. Aus den Antworten entstehen Lösungen und Ideen, die dazu führen, dass der Zielgruppe ein Prototyp des Produkts präsentiert werden kann. Noch vor der Markteinführung wird dieser Prototyp von einigen Kunden getestet und unter die Lupe genommen. Nachdem die letzten Anpassungen vorgenommen wurden, steht der erfolgreichen Produkteinführung nichts mehr im Weg.
3. Die Vor- und Nachteile von Design Thinking

Design thinking hat viele Vorteile wie z. B.:
- Echte Innovation wird vorangetrieben
- Die Lösungen werden sehr nah am internen oder externen Kunden – sie sind kundenzentriert entwickelt und helfen Kunden so bei Ihren Problemen.
- Durch eine kompakte Fokussierung auf den Prozess, werden schnell umfassende Ergebnisse möglich.
- Viele Perspektiven werden einbezogen und manchmal kommt man zu Lösungsansätzen, die sonst nicht in Erwägung gezogen werden.
- Als agiles Framework passt Design Thinking in eine Welt schnellen Wandels.
- Durch offenen Dialog auf Augenhöhe, der alle Mitarbeiter gleichwertig einbezieht, verbessert Design Thinking die Unternehmenskultur
- Es wird ein offenes Mindset entwickelt, das auch in Zukunft weiterhilft
- Die objektiv beste Lösung gewinnt, ein Einzelner drückt nicht seine Idee durch.
- Die gemeinsam entwickelte Lösung wird von allen akzeptiert: Breite Übereinstimmung bei allen Beteiligten.
- und natürlich die Lösung selbst – ein wirklich neues Produkt / neuer Service – das lässt auch Geld in die Kasse fließen.
Natürlich gibt es beim Design Thinking auch Nachteile. Diese sind:
- Der Zeitaufwand scheint erst einmal sehr hoch. Der zeitliche Aufwand sollte sich auch lohnen.
- Umständen entstehen Kosten für Arbeitseinsatz, Moderation und Raum.
4. Die fünf Phasen des Design Thinking

Design Thinking besteht in der Regel aus fünf Phasen, die fließend ineinander übergehen und auch mal übersprungen werden können. Das Ganze ist ein Kreislauf, und am Ende startet er wieder von vorn:
Phase 1: Verstehen (Empathize)
In dieser Phase geht es darum, die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Nutzer durch Interviews, Beobachtungen und Recherchen tiefgehend zu erfassen.
- Ziel: Nutzerbedürfnisse und Herausforderungen erkennen.
- Methoden: Interviews, Beobachtungen, Personas erstellen.
- Übungen: Sie möchten einen neuen Onlineshop erstellen.
- Führen Sie ein etwa 10-minütiges Interview mit einem Partner über seine größten Herausforderungen beim Online-Shopping. Versuchen Sie herauszufinden, was wie Online-Shopping für den Kunden noch angenehmer sein könnte.
- Suchen Sie sich ein Produkt oder eine Produktkategorie aus das oder aus der Sie Produkte verkaufen wollen und erstellen Sie damit eine sogenannte „Shakeholder-Map“, eine visuelle Karte mit allen Beteiligten und welchen Herausforderungen sich für sie ergibt (z. B. Lagermöglichkeiten schaffen, Personal für die Bearbeitung der Bestellungen für die Shopanbieter, sichere Verpackung, gute Anbindung an die Logistik für den Versand, gute Beschreibungen und angemessene Bezahlmöglichkeiten für die Kunden etc. ).
- Definieren Sie nun fiktive, aber realitätsnahe Nutzerprofile mit Bedürfnissen und Herausforderungen. (Wer wird typischerweise das Produkt bestellen?)
- Zeichnen Sie jetzt den Weg eines Nutzers durch den Bestellprozess auf (sogenanntes „Customer journey mapping“, also vom Ansehen im Internet über das Bestellen bis hin zur Lieferung) .
- Erstellen Sie nun einen Fragebogen mit qualitativen Interviews mit echten Nutzern, um so ihre Sichtweise zu verstehen. Was wünschen Sie sich, welche Produkte o am besten an?
- Beobachten Sie nun Nutzer bzw. Kommilitonen in ihrer natürlichen Umgebung, um unbewusste Verhaltensmuster zu erkennen. Wie gehen diese vor, wenn Sie nach einem Produkt suchen? Man nennt dies kontextuelles Bearbeiten.
Phase 2: Definieren (Define)
Die in der ersten Phase gesammelten Erkenntnisse werden in dieser Phase analysiert und in eine klare Problemstellung umgewandelt, um den Fokus für die nächsten Schritte zu setzen.
- Ziel: Das Problem präzise formulieren.
- Methoden: Problemstatements (Das Problem genau formulieren), „How Might We“-Fragen.
- Übungen: Diese Übungen beziehen sich wieder auf das Erstellen eines Onlineshops.
- Formulieren Sie eine „How Might We“-Frage basierend auf den Erkenntnissen aus Phase 1. Fragen Sie sich „Wie könnten wir…?“, um Lösungen zu inspirieren.
- Strukturieren Sie das Problem dann mit Fragen wie „Was ist das Problem? Für wen? Warum ist es wichtig?“. Dies wird „Problem Statement Canvas“ genannt.
- Fragen Sie fünfmal „Warum?“ hintereinander, um die eigentliche Ursache des Problems zu finden. (z. B. Warum wird diese Methode vom Kunden bevorzugt?“ „Warum bevorzugen Kunden ein Produkt?“) Dies ist die sogenannte „Why-Methode“.
- Gruppieren Sie nun Ihre Erkenntnisse aus der Recherche und finden Sie Muster. Man nennt dies ein „Affinity Diagramm“.
- Schreiben Sie zum Schluss ein klares Statement aus der Nutzerperspektive (z. B.: „Unser Nutzer braucht dieses Produkt, weil …“).
Phase 3: Ideen entwickeln (Ideate)
Kreativität steht in dieser Phase im Mittelpunkt – durch verschiedene Methoden wie Brainstorming oder Mind-Mapping werden viele mögliche Lösungen entwickelt, die in dieser Phase auch mal etwas unkonventionell sein können.
- Ziel: Möglichst viele kreative Lösungen finden.
- Methoden: Brainstorming, Mindmaps, SCAMPER-Methode
(Diese Methode stellt Fragen zu den sieben Bereichen:
- S – Substitute: Hier geht es darum, das Produkt oder Teile davon durch andere Konzepte/Materialien/Ansätze zu ersetzen.
- C – Combine: Wäre es auch eine Möglichkeit, das Produkt mit einem anderen zu kombinieren?
- A – Adapt: Das grundlegende Produkt, die grundlegende Idee ist ja oft gar nicht verkehrt – womöglich lässt es sich mit kleinen Ergänzungen einfach abwandeln.
- M – Modify: Kleine Änderungen können Großes bewirken! Gehen Sie hier die Eigenschaften deines Produktes durch und überlegen Sie, was Änderungen bewirken könnten.
- P – Purpose (Put to other use): Vielleicht haben Sie bisher viel zu eng gedacht. Womöglich dient dein Produkt noch ganz anderen Einsatzzwecken, als Sie bisher gedacht haben.
Mit Hilfe der Antworten werden neue Ideen generiert und auch unkonventionelle Lösungen entdeckt.)
- Übungen: Beziehen sich auch wieder auf den Onlineshop.
- 5-Minuten-Ideensprint bzw. Brainstorming – Schreiben Sie so viele Ideen wie möglich auf, ohne sie zu bewerten.
- Falten Sie dann ein Blatt in acht Felder und zeichnen Sie in 8 Minuten 8 verschiedene Ideen.
- Wenden Sie die oben genannte SCAMPER- Methode an und variieren Sie nun bestehende Lösungen durch Substituieren, Kombinieren, Anpassen usw…
- Denken Sie nun bewusst in die falsche Richtung (z. B. „Wie können wir das Problem verschlimmern?“, „Welche Erfahrungen halten Kunden davon ab, den Shop zu besuchen?) und leite daraus Lösungen ab. Dies nennt man „Reverse Thinking“.
- Erstellen Sie dann eine visuelle Karte („Mindmap“) mit Schlüsselbegriffen und Ideenverknüpfungen.
Phase 4: Prototyping (Prototype)
In dieser Phase sollen die Ideen greifbar werden.
- Ziel: Ideen greifbar machen und testen.
- Methoden: Papierprototypen, Storyboards, Mockups (Vorführmodelle). Bedienen Sie sich dabei ruhig an allen Dingen im Zimmer!
- Übungen: Auch hier geht es wieder um den Onlineshop.
- Skizzieren Sie Ihre Idee auf Papier und simulieren Sie die Nutzung („Paper-Prototyping“).
- Spielen Sie mit dem Team verschiedene Szenarien durch, um die Nutzererfahrung zu verstehen („Role-Playing“).
- Zeichnen Sie dann eine Bildergeschichte, die den Nutzungsprozess zeigt („Storyboardng“).
- Erstellen Sie Prototypen mit einfachen Materialien (Lego, Papier, Klebeband, alles was Sie im Raum finden können.) („Bastel-Prototyping“).
- Nutzen Sie zuletzt Tools wie Figma oder Marvel, um digitale Prototypen zu erstellen (Click-Dummies“).
Phase 5: Testen (Test)
In dieser letzten Phase soll das Produkt getestet und optimiert werden.
- Ziel: Feedback einholen und Lösungen verbessern.
- Methoden: Nutzertests, A/B-Tests (Testen 2er Varianten), Interviews.
- Übung: Testen Sie den Prototyp mit einem Partner und dokumentieren Sie das Feedback.
Diese Phase beinhaltet auch die Implementierung (Implement) – was manchmal noch als zusätzliche Phase aufgelistet wird.
- Ziel: Die beste Lösung realisieren.
- Methoden: Business Model Canvas, Roadmaps.
- Übungen:
- Lassen Sie den Nutzer bzw. Ihre Kommilitonen den Prototypen ausprobieren und dabei möglichst laut ihre Gedanken äußern, die Ihnen dabei durch den Kopf gehen („Think-Aloud-Test“).
- Vergleichen Sie zwei unterschiedliche Versionen einer Lösung und analysiere, welche besser funktioniert („A/B-Testing“).
- Strukturieren Sie nun das erhaltene Feedback in „Positives“, „Bedenken“, „Fragen“ und „Ideen“ (Feedback-Grid“)
- Beobachten Sie jetzt die Nutzer bzw. Ihre Kommilitonen beim Testen des Prototyps ohne dabei einzugreifen (Shadowing).
- Simulieren Sie Funktionen manuell, ohne dass der Nutzer es merkt (z. B. Chatbots, die Sie zur Lösung von Kundenfragen einsetzen, die eigentlich von Menschen gesteuert werden).
- Schreiben Sie zuletzt ihr Business-Modell wie Sie es auch präsentieren würden.
5. Bewertung des Prozesses

Nach Abschluss des Workshops bewerten die Teilnehmenden:
- Wie nutzerzentriert war die Lösung?
- Hat das Prototyping neue Erkenntnisse gebracht?
- Welche unerwarteten Herausforderungen sind aufgetreten?
- Wie würde man den Prozess das nächste Mal optimieren?
Selbstreflexions-Übung:
Schreiben Sie in 5 Sätzen auf, was du aus diesem Prozess gelernt haben und wie Sie es in Ihrem Alltag anwenden können.
6. Design Thinking in der Praxis – Beispiele: Wo wird Design Thinking genutzt und wer nutzt es?
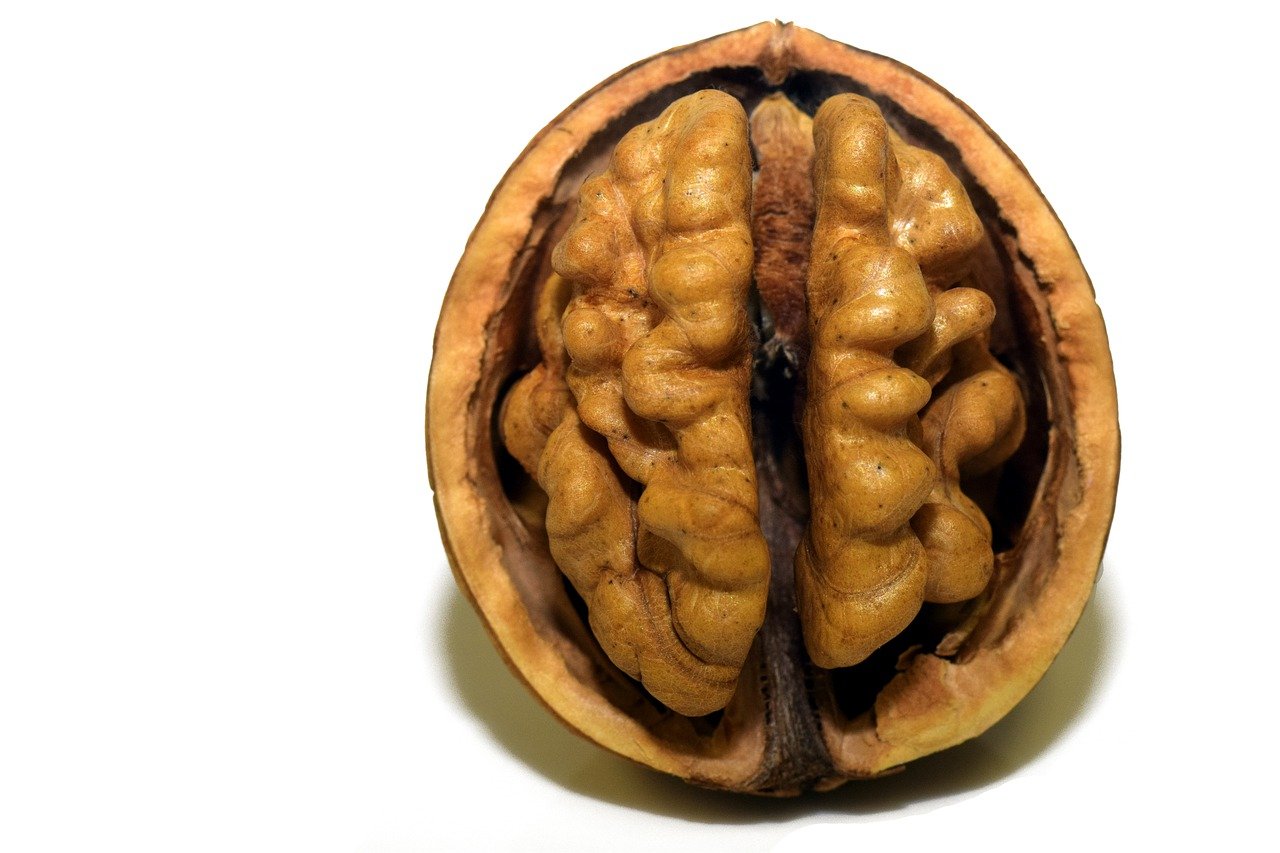
Design Thinking wird heute sehr oft in unterschiedlichsten Bereichen genutzt. Hier einige Beispiele:
- Google’s Design Sprints: Google verwendet Design Thinking zur schnellen Produktentwicklung, indem es innerhalb von fünf Tagen Prototypen entwickelt und testet.
- Die Entwicklung des Apple iPhones: Steve Jobs setzte stark auf Nutzerbedürfnisse und iteratives Prototyping – ein Paradebeispiel für Design Thinking.
- Soziale Innovationen: Ein Krankenhaus in Indien nutzte z. B. Design Thinking, um kostengünstigere OP-Methoden für ärmere Bevölkerungsschichten zu entwickeln.
- Schulen setzen Design Thinking ein, um den Unterricht kreativer und effektiver zu gestalten.
- Der Inkubator „Embracer“ der in Indien entwickelt wurde und die Sterblichkeit von Kindern massiv senkte.
- Gestaltung und Wiederbelebung des Hafengebietes der Stadt Neustein in Holstein abseits von politischen Gruppierungen und Interessen.
7. Fazit: Warum Design Thinking?
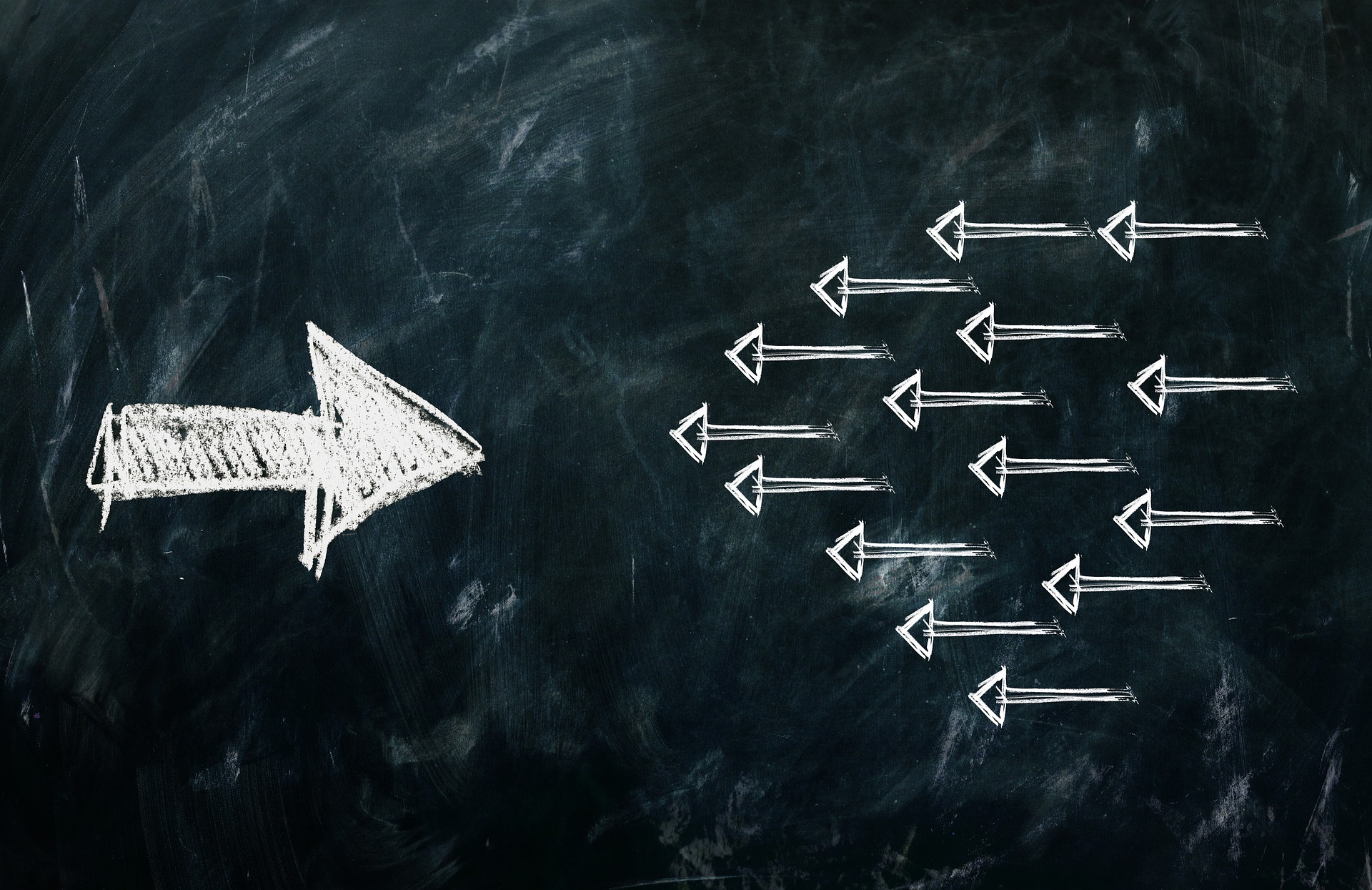
Für Design Thinking spricht vieles:
- Es fördert kreatives Problemlösen.
- Es erhöht Nutzerzentrierung und Kundenzufriedenheit.
- Es lässt sich auf viele Bereiche anwenden (Technologie, Bildung, Business).
- Es hilft Teams, innovativ und strukturiert zu arbeiten.
Bonus-Übung: Wählen Sie ein alltägliches Problem (z. B. überfüllte Unibibliotheken, Bahnen) und wenden Sie die fuünf Design-Thinking-Phasen darauf an.